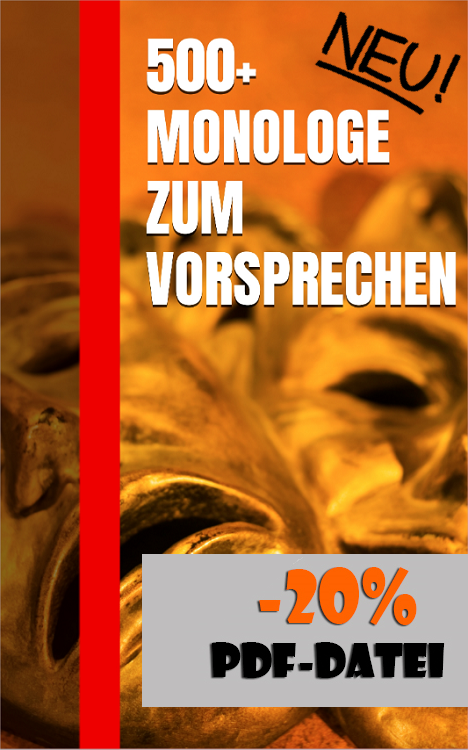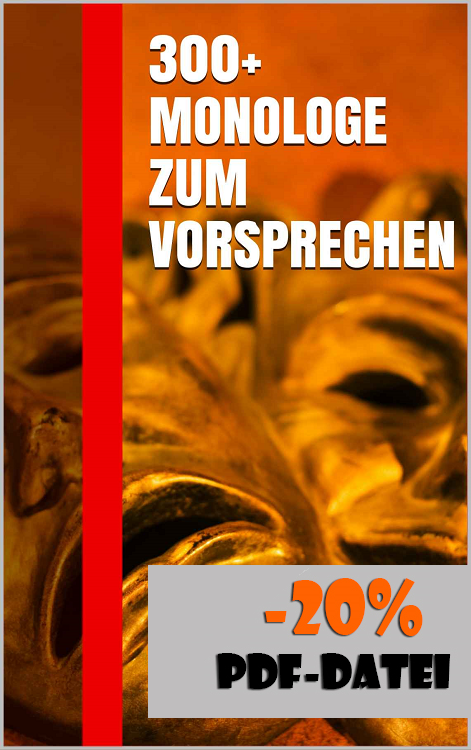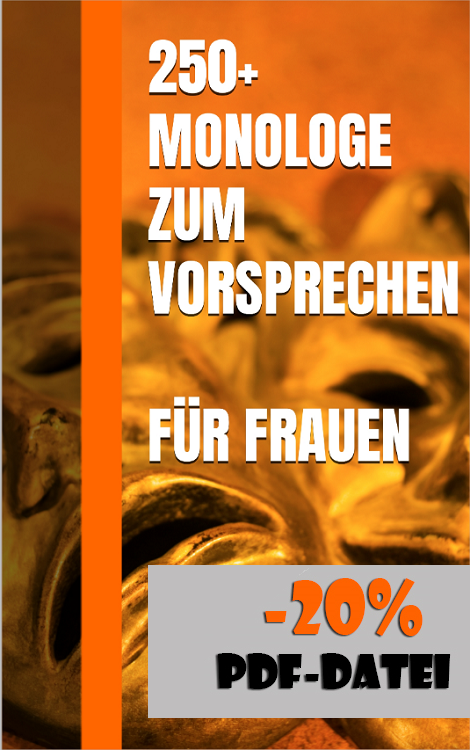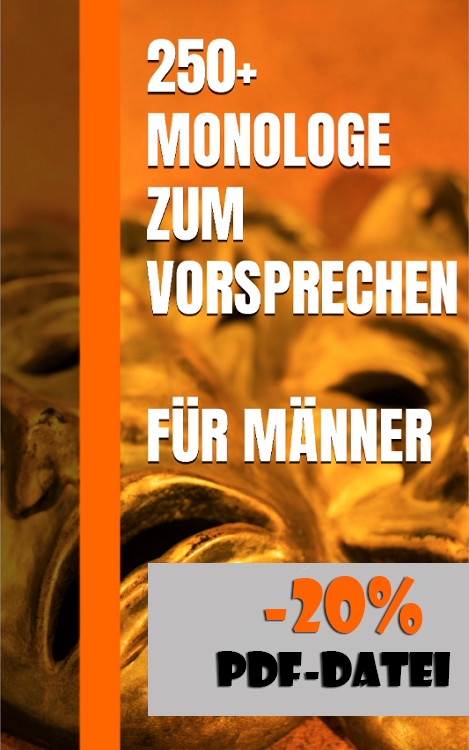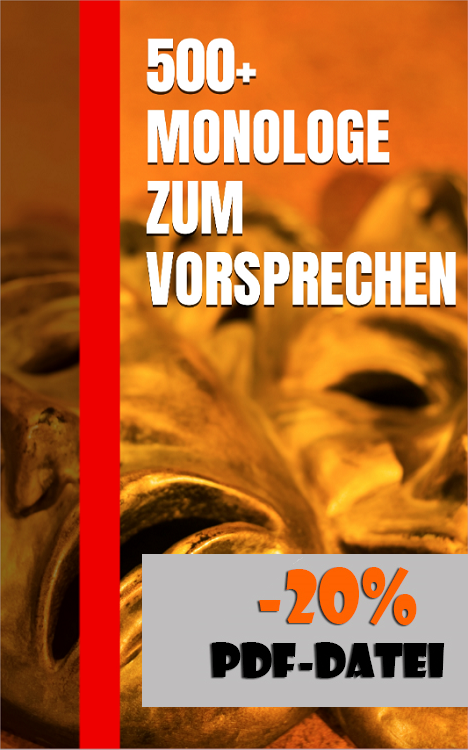Am Vorabend des Ersten Weltkriegs hat Heinrich Mann seinen Roman „Der Untertan“ publiziert. Das Kaiserreich war noch unmittelbar präsent, den Begriff „Nazis“ gab’s noch nicht, und welche fürchterlichen Gaben das Füllhorn der Geschichte für die nächsten Jahre bereithielt, war allenfalls visionären Propheten in Umrissen erkennbar. In dieser Situation hatte Heinrich Manns Roman den unschätzbaren Wert einer kühl analysierenden Prognose. Wolfgang Staudtes Filmversion von 1951 war ein fulminanter Versuch, die Romanversion in eine Folge einprägsamer Bilder zu übersetzen.
Lars Georg Vogel, der sowohl für die Bühnenversion des Romans wie auch für Regie und Ausstattung der Aufführung im kleinen Theater der „Vagantenbühne“ verantwortlich ist, greift entschlossen in die Kiste theatralischer Möglichkeiten und schlägt Kapital aus der unmittelbaren Nachbarschaft zum kaiserlichen Prachtbau des 1896 eröffneten „Theater des Westens“ und läßt dem Publikum vor Beginn der Aufführung Kopfhörer aushändigen, um die ersten Spielszenen im Hof hinter dem Theater gut verfolgen zu können. Hier ist der Antagonismus der Phrasen in einer Art Exposition zu verfolgen: der Kaiser verkündet Pathetisches aus einem höhergelegenen Fenster, Diederich Heßling gibt mit ersten hohltönenden Donnerworten seine politische Visitenkarte ab, und ein rebellischer linksgerichteter junger Arbeiter wird von Schüssen niedergestreckt. Danach wandern die Zuschauer ins hell erleuchtete Foyer vom „Theater des Westens“, hören erstmals von Lohengrin und König Heinrich als Figuren einer „deutschen Kunst“ und bewundern den Glanz der Kristall-Lüster. Sie verlassen diesen Ort zu den eingespielten Klängen des „Badenweiler Marsches“ über die seitliche „Kaisertreppe“ und gelangen erst dann in den Zuschauerraum der „Vagantenbühne“, um der eigentlichen Bühnenhandlung zu folgen. Diese „Hinführung“ im doppelten Wortsinn vermittelt bereits nützliche Impressionen vom zeittypischen Umfeld der Romanhandlung. Mobilität als Prinzip wird auch weiter kultiviert, als der zweite Teil nach der Pause erst auf einem Podest im Foyer startet, bevor die Zuschauer wieder ihre zuvor belegten Plätze im Saal einnehmen dürfen.
Nun schliessen sich Szenen aus dem Leben des Papierfabrikanten Diederich Heßling (Joachim Villegas) an, dessen markige kaisertreue Stärke eigentlich aus seiner Schwäche und Unterwürfigkeit resultiert. Die einzelnen Momentaufnahmen sind der Romanvorlage mit Geschick entnommen und gewinnen dadurch überzeugende Präsenz. Zwei Frauen kreuzen Heßlings Weg, die eher sanft romantische Agnes Göppel (Senita Huskić) und die praktische, dominante Guste Daimchen (Samira Julia Calder). Heßling dient sich empor, beim Militär wie in der kommunalen Hierarchie, wird Stadtverordneter und kann reichliche Aufträge für seine Papierfabrikation ergattern. Ein junger Mann mit Engelsflügeln (Lawrence Jordan) übernimmt die Rolle des Erzählers.
Je mehr der Erfolg Heßling Recht zu geben scheint, desto mehr verfestigt sich seine rechtskonservative Haltung, die Sozialdemokraten, Juden und materiell Schwache gleichermaßen entschieden ablehnt. Jugendfreund Wolfgang Buck (Andreas Klopp) setzt gelegentlich abweichende Akzente. Die Elterngeneration in Gestalt von Agnes’ Vater Göppel und Bucks Vater, einem inzwischen angepaßten Alt-Revolutionär, ist bei Jörg Zuch in besten Händen. Auch das karikaturistische Element findet Eingang in die Szenenfolge: glänzend der Dialog zwischen Heßling und dem einflußreichen Strippenzieher Vater Buck, der seinen eigenen Vorteil mit dem Allgemeinwohl bemäntelt, oder die Verhandlung über Grundstücksfragen: Heßling in der Mitte, links der sich windende Bürgermeister, rechts ein verknöcherter Anwalt. Heßling drischt weiter seine rechtsdrapierten Phrasen und verfällt am Ende in des Führers rhetorische Diktion. Die Zuschauer werden entlassen mit einem sehr bedenkenswerten Satz: „Der würde nicht gelebt haben, der ausschließlich in der Gegenwart lebt.“
Viel Beifall für die gelungene, bis in die Sprache sorgfältig erarbeitete Adaption eines berühmten, zeitkritischen Romans.
http://roedigeronline.de TICKETS ONLINE KAUFEN
TICKETS ONLINE KAUFENZum Inhalt: Ob schon als schwächliches Kind, ob in der Burschenschaft, ob beim Militär, in der Wirtschaft oder als Sklave im Domina-Schlafzimmer seiner Frau: Diederich Heßling kennt nur eine Tugend, und die heißt Unterwerfung. Die Vaganten Bühne unternimmt mit der Bühnenadaption von "Der Untertan" eine theatralische Reise in die Seele der Deutschen, die bestimmt wird von der Leidenschaft für Ordnung, Anpassung und Duckmäusertum. Oben der Kaiser - er war schon zu seiner Zeit die Karikatur seiner selbst und passte genau zu seinem Volk - und unten der sich lustvoll der Macht des Stärkeren unterwerfende Papierfabrikant Diederich Heßling.